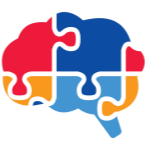Käse ist wie ein guter Hotelgast, er kommt in vielen Formen, hat unterschiedliche Eigenschaften und manche bleiben einem einfach besonders gut in Erinnerung. Ob cremig, pikant, mild oder dezent — Käse ist ein Grundnahrungsmittel mit Kultstatus. Daher ist er nicht nur ein Gerichtbestandteil, sondern ein Universum für sich.
1. Unterscheidungsmerkmale von Käse
Bevor du dich in die Käsewelt stürzt, musst du wissen, nach welchen Kriterien man Käse unterscheidet. Käse ist nämlich nicht gleich Käse.
1.1 Milchart
Die klassische Käseherstellung erfolgt aus Kuhmilch – logisch, schließlich sind Kühe in Europa der Standardlieferant. Aber Käse kann auch aus Schafs-, Ziegen- oder Büffelmilch hergestellt werden. Jede Milchart bringt ihren eigenen Charakter mit:
- Kuhmilchkäse → mild bis kräftig, ausgewogen im Geschmack
- Ziegenkäse → oft würzig, leicht säuerlich
- Schafskäse → intensiv, cremig
- Büffelkäse → reich an Fett, besonders aromatisch (Mozzarella di Bufala, anyone?)
1.2 Schimmelpilzkultur
Käse kann eine Oberfläche aus Schimmel haben — und das ist kein Makel, sondern gewollt:
- Weißschimmel → Camembert, Brie
- Rotschmierkäse → Münster, Limburger
- Blau-schimmel → Roquefort, Gorgonzola
1.3 Gerinnungsmethode
Wie wir aus Milch Käse machen? Durch Gerinnung.
Es gibt drei Methoden:
- Sauermilchgerinnung → Milchsäurebakterien sorgen für Säuerung, Eiweiß gerinnt (Frischkäse, Quark)
- Labgerinnung → Lab-Enzyme spalten Milcheiweiß, ohne die Milch zu säuern (Hart- und Schnittkäse)
- Mischverfahren → Kombination aus beiden Methoden
1.4 Reifung
Die Reifung ist der Käse-Schönheitsprozess. Manche Käse reifen nur wenige Tage (Frischkäse), andere mehrere Monate bis Jahre. Dauer und Bedingungen bestimmen Aroma, Konsistenz und Rinde.
1.5 Konsistenz
Von cremig-weich bis fest-hart – Konsistenz ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für Käse.
2. Käseherstellung
2.1 Rohstoff Milch – Die Grundlage für Käse
Alles beginnt mit Milch – und zwar frischer, sauberer Milch von hoher Qualität. Die Milch stammt überwiegend von Kühen, aber auch Schafen, Ziegen oder Büffeln. Jede Milchart bringt andere Geschmackskomponenten und physikalische Eigenschaften mit, die den Charakter des Käses bestimmen.
Wichtige Qualitätspunkte der Milch:
- Frische und Hygiene
- Fett- und Eiweißgehalt
- Keimzahl und Säuregrad
2.2 Reinigung und Pasteurisierung
Vor der Verarbeitung wird Milch gereinigt und pasteurisiert. Pasteurisierung (Erhitzen auf ca. 72 °C für 15 Sekunden oder milder Methoden wie Thermisierung bei ca. 63–68 °C) dient zur Abtötung gesundheitsschädlicher Keime und zur Verlängerung der Haltbarkeit. Dabei werden nicht alle Mikroorganismen entfernt – einige für die Reifung notwendige Kulturen bleiben erhalten.
Für Käseherstellung ist es wichtig zu wissen: Manche traditionelle Käse, z. B. Rohmilchkäse, werden nicht pasteurisiert, da dies den Geschmack wesentlich beeinflusst. Das erfordert jedoch strengere Hygiene- und Kontrollstandards.
2.3 Fettgehalt regulieren
Nach der Reinigung wird der Fettgehalt der Milch angepasst:
- Entrahmen: durch Zugabe von Magermilch wird Fett entzogen.
- Rahmzufuhr: erhöht den Fettgehalt.
Der Fettgehalt beeinflusst nicht nur den Geschmack, sondern auch die Konsistenz und Reife des Käses. Beispielsweise ergibt eine höhere Fettmenge cremigere, mildere Käse, während fettärmere Sorten fester und würziger werden.
2.4 Dicklegen – Die Gerinnung
Das Herzstück der Käseherstellung: Milch muss gerinnen und eine Dickete (Gallerte) bilden. Es gibt zwei grundsätzliche Verfahren:
a) Sauermilchkäse
- Impfung mit Milchsäurebakterien (z. B. Lactococcus lactis, Lactobacillus spp.).
- Die Milchsäurebakterien wandeln Lactose in Milchsäure um, senken den pH-Wert und bringen das Milcheiweiß (Casein) zum Gerinnen.
- Ergebnis: Sauermilchquark bzw. Sauermilchbruch.
- Beispiele: Frischkäse, Speisequark, Harzer Käse.
Info: Der pH-Wert bei der Dicklegung liegt typischerweise bei ca. 4,6, was die Bildung eines stabilen Protein-Netzwerks ermöglicht.
b) Süßmilchkäse (Labkäse)
- Zusatz von Lab – einem Enzymgemisch, ursprünglich aus dem Kälbermagen, heute auch mikrobiell oder gentechnisch hergestellt.
- Lab spaltet das Casein in der Milch, ohne den pH-Wert wesentlich zu verändern.
- Die Milch gerinnt „süß“, ohne sauer zu werden.
- Ergebnis: Käsebruch.
Fachinfo: Lab enthält die Enzyme Chymosin, Pepsin und Lipasen, die nicht nur die Gerinnung, sondern auch die Geschmacksbildung beeinflussen.
2.5 Bruchschneiden – Die Käseharfe im Einsatz
Nach der Gerinnung wird die Dickete in kleine Bruchstücke geschnitten, um die Molkeabgabe zu fördern.
- Je kleiner die Bruchstücke, desto mehr Molke tritt aus → festere Käsesorten.
- Große Bruchstücke → weichere, cremigere Käse.
Technik: Käseharfe oder Schneidrähm → präzise Schnitte in Würfelform.
Rühren und Erwärmen verstärken die Molkeabgabe und beeinflussen die Textur.
2.6 Molkeabzug und Formen
Nach dem Schneiden und Rühren wird der Bruch von der Molke getrennt. Die Molke wird teilweise weiterverarbeitet (z. B. zu Molkepulver oder als Zusatz für Tierfutter).
Der Käsebruch wird nun in Formen gegeben:
- Formgebung: rund, quadratisch, Laib, Rad, kleine Portionen.
- Formen beeinflussen das Aussehen und die Reifung des Käses.
Beim Süßmilchkäse erfolgt oft zusätzlich ein Erwärmen des Bruchs:
- Körner ziehen sich zusammen.
- Mehr Molke tritt aus.
- Käse wird fester.
2.7 Salzen – Geschmack und Haltbarkeit
Salzen hat drei Funktionen:
- Geschmack: Salz beeinflusst Aroma und Würze.
- Haltbarkeit: Salz hemmt das Wachstum unerwünschter Mikroorganismen.
- Konsistenz: Salz entzieht dem Käsebruch Flüssigkeit.
Salz kann durch Trockenbehandlung oder Salzbad (Lake) zugeführt werden.
2.8 Reifung – Käse erhält Charakter
Die Reifung (Affinage) ist das Herzstück der Käseherstellung – hier entwickelt der Käse seine Aromen, Konsistenz und Rinde.
Unterschiede bei der Reifung:
- Sauermilchkäse: ca. 2 Tage Vorreifung, anschließend zusätzliche Kulturen (Bakterien, Schimmelpilze) → 3–5 Tage bei 12–16°C.
- Süßmilchkäse: je nach Sorte mehrere Wochen. Weichkäse → 1–2 Wochen, oft von außen mit speziellen Kulturen besprüht (Schimmel- oder Edelpilze).
- Hartkäse → monatelange Reifung, teilweise Jahre.
Info: Reifung erfolgt enzymatisch (Lab, Mikroorganismen) und mikrobiell (Oberflächenkulturen), wodurch komplexe Aromen entstehen.
3. Einteilung der Käsegruppen
Käse lässt sich auf verschiedene Arten einteilen — die gängigste ist nach Konsistenz und Fettgehalt.
3.1 Nach Konsistenz
| Käsegruppe | Eigenschaften | Beispiele |
|---|---|---|
| Frischkäse | keine Reifung, hohe Feuchtigkeit, verschiedene Fettstufen | Quark, Doppelrahmfrischkäse, Mozzarella, Cottage Cheese |
| Weichkäse | 38–52 % i.Tr., Schmierbildung oder Schimmelbildung | Brie, Camembert, Limburger, Münster |
| Halbfester Schnittkäse | 44–56 % i.Tr., formstabil, aber weich | Butterkäse, Esrom, Tilsiter |
| Schnittkäse | 49–61 % i.Tr., formstabil | Gouda, Edamer, Danbo |
| Hartkäse | ≥62 % i.Tr., lange Reifezeit, kräftiger Geschmack | Emmentaler, Bergkäse, Parmesan, Cheddar |
3.2 Nach Fettgehalt (in Trockenmasse, i.Tr.)
| Stufe | Fettgehalt i.Tr. |
|---|---|
| Doppelrahmstufe | 60–87 % |
| Rahmstufe | 50–59 % |
| Vollfettstufe | 45–49,5 % |
| Fettstufe | 40–44,9 % |
| Dreiviertelfettstufe | 30–39,9 % |
| Halbfettstufe | 20–29,9 % |
| Viertelfettstufe | 10–19,9 % |
| Magerstufe | 0–9,9 % |
3.3 Spezialitäten
- Schmierkäse → mit Rot- oder Gelbschmiere: pikanter Geschmack, besondere Pflege notwendig (z.B. Limburger)
- Schimmelkäse → Weißschimmel oder Blauschimmel: intensiver Geschmack, besondere Reifungskultur
5. Die Käsearten im Detail
Die folgende Übersicht gibt soll dir einen kleinen, kompakten Blick auf die Vielfalt der Käsewelt geben. So weißt du nicht nur, was du servierst, sondern kannst deinen Gästen auch fundierte Empfehlungen geben die Liste kannst du natürlich gern kopieren und mit den Käseärten in deinem Ausbildungsbetrieb erweitern.
| Käseart | Herkunft | Milchart | Reifezeit | Geschmack |
|---|---|---|---|---|
| Mozzarella di Bufala | Italien (Kampanien) | Büffelmilch | frisch (keine Reifung) | mild, cremig, leicht süßlich |
| Quark | Deutschland, Österreich | Kuhmilch | frisch | mild, leicht säuerlich |
| Brie de Meaux | Frankreich | Kuhmilch | 4–6 Wochen | mild, cremig, erdig |
| Camembert de Normandie | Frankreich | Kuhmilch | 3–5 Wochen | mild, leicht nussig, cremig |
| Limburger | Deutschland (Rheinland, Bayern) | Kuhmilch | 2–4 Wochen | kräftig, pikant, würzig |
| Tilsiter | Deutschland, Schweiz | Kuhmilch | 4–6 Wochen | mild bis pikant |
| Butterkäse | Deutschland | Kuhmilch | 2–4 Wochen | mild, buttrig |
| Edamer | Niederlande | Kuhmilch | 4–12 Wochen | mild, leicht salzig |
| Gouda | Niederlande | Kuhmilch | 1–12 Monate | mild bis kräftig, nussig |
| Emmentaler | Schweiz | Kuhmilch | 3–12 Monate | nussig, süßlich, aromatisch |
| Parmesan (Parmigiano Reggiano) | Italien | Kuhmilch | min. 12 Monate | kräftig, würzig, nussig |
| Comté | Frankreich | Kuhmilch | 6–24 Monate | würzig, nussig |
| Roquefort | Frankreich | Schafsmilch | 3–6 Monate | intensiv, würzig, pikant |
| Gorgonzola | Italien | Kuhmilch | 2–3 Monate | würzig, cremig, leicht pikant |
| Cottage Cheese | USA, UK | Kuhmilch | frisch | mild, leicht säuerlich |
5.1 Zusatzinfos zur Tabelle
- Reifezeit: beeinflusst Geschmack und Aroma. Je länger gereift, desto intensiver.
6. Käse in der Praxis
Hier noch ein paar Tipps, die dir helfen, Käse im gastronomischen Alltag perfekt zu handhaben:
6.1 Präsentation
- Käseplatten: sortiere von mild zu kräftig.
- Frischkäse: separat servieren, damit der Geschmack nicht verloren geht.
- Schimmelkäse: immer mit separatem Messer anbieten, um Geruchsübertragung zu vermeiden.
6.2 Lagerung
- Käse nie luftdicht in Plastikfolie lagern.
- Käse in Käsepapier oder Stoff wickeln, damit er atmen kann.
- Idealtemperatur: 8–12°C.
6.3 Serviertemperatur
Käse entfaltet sein Aroma bei Zimmertemperatur. Also 30–60 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen.
6.4 Kombinationen
- Weichkäse → Obst, Nüsse, Honig
- Hartkäse → Trauben, Birne, Nüsse
- Blauschimmelkäse → Honig, Feigen, Portwein
- Frischkäse → Kräuter, Tomaten, Schnittlauch